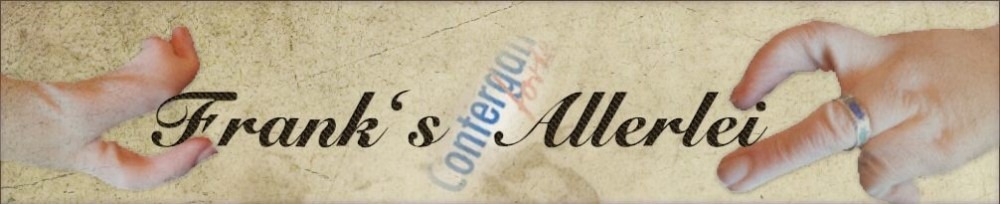Quellen
http://rechtsanwalt-schwenke.de/ing-diba-veganer-und-die-grenzen-des-hausrechts-auf-facebook-fanseiten/
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Hausverbot
Das virtuelle Hausrecht
Das virtuelle Hausrecht ist bereits mehrfach in Gerichtsentscheidungen anerkannt. Wer das Recht hat über die Nutzung eines Internetangebotes zu bestimmen, darf auch die Grenzen der Nutzung setzen.
Dieses Recht ist vor allem beim Aufbau von Communities wichtig. Wenn Sie zum Beispiel eine Community rund um eine Marke aufbauen, können Sie bestimmen, dass auch die Diskussionen einen Markenbezug haben. Sie können zum Beispiel Diskussionen um Konkurrenzmarken oder brisante Themen wie Religion oder Politik ausklammern. Damit können Sie dank dem Hausrecht Leitplanken für die Diskussionskultur setzen.
Das Hausrecht berechtigt Sie:
Nutzerbeiträge zur korrigieren oder zu löschen
Nutzern ein virtuelles Hausverbot zu erteilen (was bei Facebook praktisch durch die Nutzer-Blockierfunktion umgesetzt wird)
Was bei der Anwendung des Hausrechts auf Facebook zu beachten ist
Das Hausrecht ist nicht grenzenlos. Es wird im Fall von Facebook-Fanseiten durch Facebooks Nutzungsbedingungen und das Gesetz eingeschränkt:
Sachliche Erwägungen und keine Willkür
Sie dürfen sich nicht willkürlich Meinungen oder Fans aussuchen. Sie dürfen Nutzer nur dann aussperren oder ihnen die Meinung verbieten, wenn Sie einen sachlichen Grund dazu haben. Sachliche Gründe sind.
Störung des Geschäftsbetriebs – Der Geschäftsbetrieb einer Fanseite ist gestört, wenn sie ihren Zweck nicht erfüllen kann. Dieser liegt bei einer Bankseite u.a. in der Imagepflege, Vorstellung eigener Angebote oder Beantwortung von Kundenproblemen. Natürlich gehört auch Kritik dazu. Diese darf aber nicht wie in dem hier besprochenen Fall dazu führen, dass die Fanseite im Übrigen lahm gelegt wird.
Rechtliche Gefahren – Das Hausrecht darf ausgeübt werden, wenn für den Betreiber oder seine Nutzer rechtliche (Haftungs)Gefahren drohen. Zum Beispiel, wenn Beleidigungen, falsche Tatsachenbehauptungen oder Urheberrechtsverletzungen gepostet werden.
Transparenz
Für die Nutzer muss erkennbar sein, wie sie sich zu verhalten haben und was der Grund Ihrer Maßnahmen ist. Das ist in der Regel schon anhand des Zwecks der Seite möglich. Eine Bankseite ist zum Beispiel kein Diskussionsforum für Essgewohnheiten. Ist erst ein Mal der Fanseitenbetrieb aus dem Ruder gelaufen, sollten spezielle Maßnahmen angekündigt oder zumindest erklärt werden. Zum Beispiel sinngemäß:
Wir werden die Beiträge ab Morgen einzeln frei geben. Wir begrüßen den Regen Meinungsaustausch über unseren Werbespot und nehmen die Diskussion ernst, möchten Sie jedoch auf die bereits vorhandenen Beiträge zum Thema beschränken. Das erachten wir als notwendig, um auch auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen zu können, die Fragen und ein Informationsinteresse an anderen Themen haben.
Nutzungsbedingungen von Facebook beachten
Laut Facebooks Nutzungsbedingungen für Seiten (Nr. 9, Stand 10.01.2012) dürfen Seitenbetreiber keine eigenen Richtlinien aufstellen. Das heißt, Sie dürfen zum Beispiel nicht bestimmen, dass Ihre Fanseite nur noch für Kundenanfragen, aber keine Kritik verwendet werden darf. Oder dass sie nur durch Privatpersonen genutzt werden darf. Jedoch dürfen Sie weiterhin durchgreifen, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten oder Rechtsverstöße zu vermeiden. Sie dürfen auch eine “Netiquette” führen, in der auf die Einhaltung dieser Punkte hingewiesen wird.
Gesetzliche Regeln beachten
Sie sollten es unbedingt vermeiden, dass man Ihnen eine der folgenden Benachteiligungen aus dem § 19 des Allgemeines Gleichbehandlungsgesetzes vorwerfen kann:
Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität
Das heißt, bleiben Sie allgemein. Wenn es bei Ihnen um eine Diskussion zum Thema Christentum vs Islam geht, weisen Sie darauf hin, dass Sie wegen des Themas eingreifen und nicht wegen einzelner Meinungen.
Fragen Sie die Social Media-Abteilung
Sollte Ihr Unternehmen über eine Social Media Abteilung oder PR-Abteilung verfügen, fragen Sie sie bevor Sie einschreiten. Dieser Schritt ist keine rechtliche Voraussetzung, aber mindestens genauso wichtig. Vor allem Vorgesetzte und Geschäftsinhaber mit Administrationszugang können mit voreiligen Schritten mehr schaden als helfen. Es kann auch durchaus sein, dass die Marketingfachleute den Nutzersturm auszunutzen wissen. Oder abwarten und auf das wirksamste aller Schutzmaßnahmen gegen negative Nutzerproteste zurück greifen wollen – die positiven Gegenmeinungen treuer Fans.
Folgen bei Verstößen
Die rechtlichen Folgen sind das geringste Risiko. Rein theoretisch können Sie von Nutzern verklagt werden, wenn Sie sie ausgesperrt haben. Das dürfte bei Facebook-Seiten jedoch so gut wie nie passieren.
Das viel größere Risiko liegt in der Reaktion der Nutzer. Längst wurden Gerichte von der Macht der Nutzer als Kontrollinstanzen in solchen Fällen abgelöst. Negative Kritik und Imageverluste sind die größten Gefahren. Die oben genannten Punkte helfen Ihnen auch diese Gefahr zu vermeiden. Denn auch wenn Sie rechtlich klingen, sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen und sollen einen fairen zwischenmenschlichen Umgang sichern. Das heißt, wenn Sie die Regeln bei der Anwendung Ihres Hausrechts beachten, werden Sie Ihr Risiko gering halten.
Fazit und Praxisempfehlung
Das Hausrecht ist ein wichtiges Ordnungsinstrument, das auf eine lange Tradition in der “realen Welt” zurückblickt. Sie sollten die dabei gewonnenen und im Gesetz verankerten Erfahrungen beim Umgang mit Konfliktsituationen auf Ihrer Facebook-Fanseite einsetzen. So behalten Sie die größtmögliche Kontrolle und Minimieren die Gefahr von Nutzerprotesten und Shitstorms.